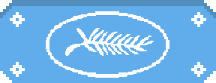
Das Spiel mit dem Krieg
Viele Videospielentwickler kämpfen auf dem schmalen Grat zwischen Realität und möglichst viel Spielspaß. Die Ergebnisse sind lange nicht immer zufriedenstellend.
Für das kürzlich erschienene Medal of Honor: Warfighter kann es nicht realistisch genug sein. Das Spiel setzt wie kaum ein anderer moderner Militär-Shooter auf reale Schauplätze, Geschehnisse und Personen. Alle Missionen sind mit dem Vermerk: "Inspiriert durch wahre Ereignisse" gekennzeichnet, die Taktiken wurden von echten Spezialeinheiten überwacht. Der Boss-Endgegner trägt zwar den Spitznamen "Der Kleriker", ist aber faktisch niemand anderes als der weltweit bekannteste Terrorist Osama bin Laden. Dieser knallharte Realitätsbezug macht Medal of Honor: Warfighter allerdings nicht zu einem guten Spiel. Im Gegenteil: Vor lauter Authentizität haben die Entwickler vergessen, solides Gameplay zu liefern.
Dass sich moderne Militär-Shooter an der Realität orientieren, ist trotzdem einer der Hauptgründe für ihre Beliebtheit. Die Spiele verstärken einen Bewusstseinszustand: Es herrscht Krieg. Nicht hier, aber irgendwo auf dem Planeten. Weit genug weg, um nicht real gefährlich zu sein. In diesem Krieg geht es immer auch um unsere Interessen und trotzdem haben wir so gut wie keinen Anteil daran. Alles was wir wissen ist, dass sich der moderne Krieg nicht mehr auf ein Land und zwei verfeindete Parteien reduzieren lässt.
Der moderne Krieg ist global, seine Methoden sind subtiler und gleichzeitig brutaler als früher. Die Konflikte sind Bürgerkriege und die Opfer Zivilisten. Die großen Geschütze rosten vor sich hin - gekämpft wird hauptsächlich mit Handfeuerwaffen. Staaten, die ihr Gewaltmonopol nicht mehr durchsetzen können, ziehen Terroristen an, die den Terror wiederum in die ganze Welt exportieren. Die westlichen Mächte intervenieren, entweder im großen Stil einer UN-Mission oder wie die USA im Alleingang. Manche agieren auch nur verdeckt, indem sie bestimmte Parteien mit Ressourcen unterstützen. Die verdeckte Operation ist aus dem Maßnahmenkatalog nicht mehr wegzudenken und ihre Agenten sind die idealen Protagonisten für den Krieg der Zukunft. Sie sind durchtrainiert, bestens ausgerüstet und geheimnisvoll.
Die Modern Warfare-Reihe bringt uns diesen Typ Mensch näher. Männer wie Soap MacTavish oder Captain Price - einsame Helden, die für uns in den Krieg ziehen und tun, was nötig ist. Diese Figuren ähneln sich in fast allen vergleichbaren Shootern. Es sind Soldaten, die in erster Linie für den Konflikt leben und kämpfen, obwohl sie wissen, dass das System korrupt ist. Ihre Gegner sind Unmenschen, bevorzugt aus dem mittleren Osten oder der ehemaligen Sowjetunion, die lediglich ein Ziel haben: Die Welt brennen zu sehen. Das hat absolut Methode, denn wenn der Gegenspieler der Böse ist, ist man selbst automatisch der Gute.
Das Bild, das an dieser Stelle in Video- und Computer-spielen produziert und reproduziert wird, ist weit verbreitet: Dem globalen Terror werden wir nur mit Spezialkräften Herr. Mit kleinen Teams, die überall auf der Welt intervenieren können und uneingeschränkte Befugnisse haben. Moderne Judge Dredds eben. Frei nach dem Grundsatz, dass schlimme Zeiten eben schlimme Maßnahmen erfordern, foltern wir Gefangene oder töten als Undercover-Agent Zivilisten - natürlich alles für das Allgemeinwohl. Aber das System ist korrupt, genau wie unsere Vorgesetzten. So wird unser Kampf ab einem gewissen Punkt nur noch durch persönliche Rachegefühle legitimiert.
Manche Shooter erkennen, dass ihnen zu viel Realität schadet und kriegen gerade noch die Kurve. Call of Duty: Modern Warfare überschreitet die Linie das eine oder andere Mal - geht aber im Großen und Ganzen einen guten Mittelweg. Das Spiel orientiert sich an der Wirklichkeit, allerdings ohne den Anspruch zu erheben, sie eins zu eins abzubilden: Russland zerfällt in zwei Lager, irgendein Schurkenstaat im Mittleren Osten zündet eine schmutzige Atombombe - alles kein Problem. Das Spiel bedient sich frei der Brennpunkte dieser Welt und schickt uns dabei einmal rund um den Globus. Die typischen Perspektivwechsel lassen uns die Schlacht aus vielen unterschiedlichen Blickpunkten erleben und sorgen für ein intensives Spielerlebnis. Mit zunehmendem Realitätsanspruch kommt jedoch die Verantwortung. Wenn die Konflikte real sind und auch die Personen, auf die wir es abgesehen haben, wo verläuft dann die Grenze zwischen Spiel und Realität? Aber vor allem: Wo versteckt sich die Kreativität?
Medal of Honor: Warfighter macht keinen Hehl aus seiner offenkundigen Abneigung gegen Pakistan. Im Hunt-Erweiterungspaket versetzt uns die Karte Chitra in den gleichnamigen Bezirk in der pakistanisch-afghanischen Grenzregion. Dort sollen wir faktisch Osama bin Laden aufspüren, auch wenn er nicht so heißt. Es sind alles reale Orte und Situationen. Real sind aber auch die Drohnenangriffe der USA, die in der pakistanischen Grenzregion immer wieder zivile Menschenleben fordern. Das schürt die anti-amerikanische Stimmung und stärkt die Fundamentalisten. All das ist kein Spiel, gehört aber wohl in eines, das die Wirklichkeit abbilden will. Es stellt sich trotzdem die Frage: Muss es so ernst sein? Wohin viel Ernsthaftigkeit führt, sehen wir bei Spec Ops: The Line. Die Hölle des Krieges wird hier so plastisch beschrieben, dass einem schon mal die Lust am schießen vergeht. Das Spiel ist gut, aber kein reiner Shooter. Es ist eines der wenigen, waschechten Antikriegsspiele.
In manchen Fällen führt die Jagd nach Realismus auch zu sehr realen Konsequenzen. So zum Beispiel bei Bohemian Interactive, den Machern der Arma-Simulationen. Zwei Mitarbeitern des tschechischen Entwicklers drohte eine saftige Haftstrafe wegen Spionage, weil ihnen vorgeworfen wurde, auf der griechischen Insel Lemnos illegal eine Militärbasis fotografiert zu haben. Die beiden Entwickler sagten, sie waren im Urlaub - und sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß.
Dass es auch mit weniger Realismus geht, zeigt DICE aus Schweden. Deren Battlefield-Reihe setzt schon seit Jahren erfolgreich auf den Dritten Welt-krieg zwischen Russland und den USA. Die Bad Company-Reihe liefert dazu eine aufregende und witzige Kampagne, im Stil von Three Kings. Ein Krieg gegen die Russen, ein paar fiese Bösewichte und eine Portion Selbstironie - das ist ganz wunderbar. Die Kampagne von Battlefield 3 hingegen nimmt sich wieder viel zu ernst, spielt sich wie Kriegspropaganda im Kontext des aktuellen Irankonflikts.
Mit solch plumpen Aktionen werden Spieler für dumm verkauft. Wir spielen Shooter, um Spaß zu haben und nicht, um uns rekrutieren zu lassen. Dass Medal of Honor: Warfighter seine virtuellen Bösewichte als "reale Bedrohung" anpreist, ist ganz klassische, amerikanische Panikmache. Es gehört sich aber nicht, ein Spiel derart zu instrumentalisieren. Zumal ein Spiel nicht das richtige Medium ist, um auf "reale Bedrohungen" aufmerksam zu machen. Was der Kampagne gut getan hätte: Ein überzeugender fiktiver Bösewicht, um starke Antipathien zu schüren.
Es gibt viele gute Beispiele dafür, wie man reale Bezüge in eine fiktive Rahmenhandlung einbauen kann. Homefront meistert das hervorragend. Die Story von US-Schriftsteller John Milius ist großartig. Nordkorea überrennt Südkorea, bildet eine asiatische Supermacht und überfällt die USA. Dieses Szenario basiert auf ausreichend Fakten, um real vorstellbar zu sein. Und es ist gleichzeitig so weit entfernt von der Realität, dass wir es nicht ernst zu nehmen brauchen. Gerade deswegen macht es Spaß, mit Leib und Seele gegen die asiatischen Unterdrücker zu kämpfen.
Ohne das Böse kann es das Gute nicht geben. Ohne einen Feind gibt es keinen Krieg. Wenn es uns schwerfällt, den Feind zu benennen, ihn zu finden und zu bekämpfen, sollten wir uns fragen, ob er es wert ist, Krieg gegen ihn zu führen - im Spiel wie in der Realität. Im Umkehrschluss bedeutet das: Je stärker das Feindbild, desto intensiver ist zwangs- läufig das Kampferlebnis.
Die besten Feindbilder finden sich aber nicht in der Welt von morgen, sondern weit weg im Weltall. Auf Helgan, dem Killzone-Planeten beispielsweise. Auf Sera, dem Gears of War-Planeten oder Requiem, wo wir in Halo 4 die Aliens angreifen. Als Feinde sind die Helgast und die Locust unübertroffen: Sie sind böse und hässlich, eine teuflische Plage und wir sind die Einzigen, die sie aufhalten können. Selten hat der Krieg so viel Spaß gemacht. Und auch die Halo-Serie bietet mit den Völkern der Alien-Allianz, den parasitären Flood oder den Prometheanern ein starkes, wenn auch nicht ganz so beängstigendes Feindbild.
Abgesehen vom Feindbild gibt es nur noch eine lebenswichtige Komponente für einen guten Shooter: die Waffen. Hier ist nicht in erster Linie der Realismus entscheidend, sondern das "runde" Gefühl. Passt der Sound? Ist das Design überzeugend? Sind die Animationen beim Nachladen perfekt? Natürlich sind die Geschmäcker verschieden. Wer auf der Suche nach dem ultimativen Waffenwahnsinn ist, wird ihn vielleicht in Borderlands 2, in Halo 4 oder am Ende dann doch in Battlefield 3 finden.
Das Wort Shooter erklärt, was bei dieser Spielart wichtig ist: die Waffen und unsere Ziele. Bei beiden Aspekten ist es sinnvoll, sich an der Wirklichkeit zu orientieren. Allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Denn wenn wir die Welt so detailgetreu wie möglich nachbilden, ist da plötzlich kein Spiel mehr, sondern ein Simulator. Das ist bei Rennspielen toll, Shooter aber brauchen starke Feinde, auf die wir schießen können, ohne uns danach schlecht zu fühlen oder das Gefühl zu haben, für irgendeine Staatsmacht in den Krieg gezogen zu sein. Militär-Shootern wird diese Gratwanderung nie so leicht fallen wie Sci-Fi-Shootern. Wenn sie aber zudem noch auf jegliche Kreativität verzichten und sich stattdessen einfach dem unverblümten Realismus verschreiben, machen sie es sich und uns doppelt schwer.
